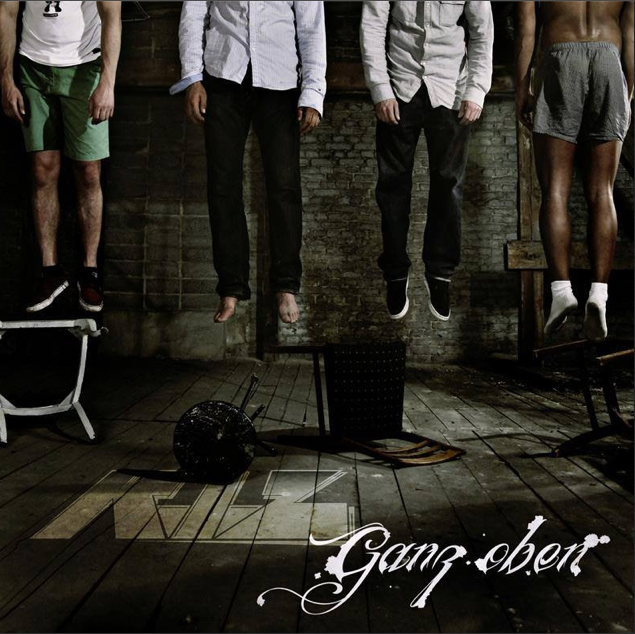früher Deschek vom Message, heute nur noch als Wödscheim-Co-Host aktiv.
In einem stillgelegten Hotel am Semmering sitzt Spilif – lässig und ganz in Blau gekleidet mit verschränkten Beinen vor einem leeren Bilderrahmen. Es ist das Cover ihres im Oktober erschienenen Debütalbums „irgendetwas das du liebst“, das voll reflektierter Poesie und jazzig-funkigen Bandklängen jedem Unbehagen trotzt. Wir treffen die Innsbrucker Rapperin sitzend, tief eingesunken und ähnlich entspannt im samtgrünen Sessel eines Wiener Kaffeehauses vor ihrer Releaseshow. Ein Gespräch über Sprache, Grundzufriedenheit und Musik.
The Message: Du hast dich schon in der Schulzeit viel mit Sprache beschäftigt. Wie hat die Leidenschaft begonnen und was waren die ersten Sachen, die du aktiv gemacht hast?
Spilif: Ich habe Bertolt Brecht gelesen (lacht). Ich habe immer sehr gute Deutschprofessoren gehabt. Ich bin gern in die Schule gegangen. In der Katholischen Privatschule gab es einen Lehrer, der sehr penibel war, wie Sprache verwendet wird. Dann habe ich angefangen ein bisschen zu schreiben, vor allem Geschichten – ich glaube, da ging es viel um Liebe. Und ich war vielleicht ein bisschen proletiger unterwegs. Wir waren alle Snowboarder und Skater. Es gab ein kleines Studio im Jugendhaus, wo gefreestylt worden ist. Irgendwann habe ich auch angefangen, Raps zu schreiben.
Ist dir das geblieben, dass du sehr erpicht darauf bist, wie Sprache verwendet wird?
Ja, ich bin da richtig scheiße, ich kann das überhaupt nicht. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, wir kommen da auf keinen gemeinsamen Zweig oder auf einen grünen Nenner. Es macht mich ganz fertig, wenn die Leute Sprichwörter falsch verwenden oder Grammatikfehler machen.
Wie kritisch bist du bei deinen eigenen Texten?
Voll kritisch. Ich nehme eine Demo auf und dann höre ich mir den Song so oft in Dauerschleife an, bis ich keine emotionale Verbindung mehr dazu habe. Dann probiere ich, wie ein Kritiker zuzuhören. Es gibt manchmal Füllerzeilen oder Reime, die komisch gesetzt sind. Die sind ganz in Ordnung, wenn man es hört, aber sobald man emotional davon entfernt ist, ist es nicht mehr so cool. Wenn der Prozess vorbei ist, nehme ich alles nochmal auf und dann kommt die Emotion wieder.
Die Vereinfachung der Alltagssprache und ein immer größer werdender Gebrauch von Anglizismen sind ja ein bisschen ein Thema, nicht nur im Rap. Wie stehst du dazu?
Oh, Anglizismen verwende ich auch. Ich habe das lange schrecklich gefunden, aber ich tue es selbst. Ich würde jetzt behaupten, dass meine Lyrik nicht so vereinfacht und so heruntergebrochen ist. Es gibt aber auch wunderschöne Popsongs, die lyrisch super einfach sind. Und ja, die Sprache verändert sich.
Wie gehst du generell mit dem Wandel der Sprache um?
Ich denke, man muss es ein bisschen mitmachen. Solange man sich selbst wohlfühlt, passt es. Die Sachen, die ich sage, verwende ich in meinem täglichen Sprachgebrauch. Auch die Anglizismen. Meine Mutter würde sicher behaupten, dass ich die Sprache mit meinen Jugendwörtern verhunze – und ich bin jetzt auch schon Mitte 30. Ich probiere aber nicht, auf Krampf etwas einzubauen, damit mich die Jugend versteht.
„Ich will schon auch ein bisschen in die Popschiene, aber die Rap-Message soll trotzdem bleiben“
Zu einer anderen Generation: Dein Album beinhaltet unter anderem Verweise auf Rio Reiser und Hildegard Knef. Haben deine Eltern viel Musik-Bezug?
Ja, mein Vater war Vinyl-DJ in den 80er-Jahren. Er hat zum Beispiel Platten von Billy Joel oder Boby Dylan gespielt. Billy Joel ist eh mein absoluter Lieblingskünstler. Meine Mama ist Pädagogin und spielt viel Gitarre.
Hast du jemals gedacht, dass du mal Rapperin wirst?
Ja, irgendwann schon einmal. Aber es war jetzt nicht mein Ziel, Rapperin zu werden und ich habe nicht deswegen angefangen zu schreiben. Es hat sich super organisch entwickelt. Ein paar Leute haben mich live spielen lassen. Dann war das cool. Aber die Intention gab es nie.
Du hast dann einfach das gemacht, was…
…du liebst? Ja, genau so ist es.
Soll der leere Rahmen des Covers irgendetwas von dem, was man liebt, symbolisieren?
Ja, tatsächlich. Es war ursprünglich ein Foto von irgendeinem Schloss in Wien drauf, das wir rausretuschiert haben. Es ist natürlich auch eine lässige Box zum Unterschreiben.
Und bei dir würde nicht nur Rap im Rahmen drinstehen?
Ich liebe Rap und HipHop. Aber es gibt viele Dinge, auf die ich weniger verzichten kann. Es klingt vielleicht kitschig, aber es gibt so viele Menschen, die ich sehr bewundere und liebhabe. Ich kann auch ohne Fotografie schwer leben. Das hat auch wieder etwas mit Menschen zu tun, denn ich fotografiere die Leute gern, wenn sie eine gute Zeit haben.
Du rappst: „Mein größter Flex ist die Grundzufriedenheit.“ Wie intensiv beschäftigst du dich allgemein mit philosophischen Themen?
Philosophie ist ein riesiges Thema in meinem Leben. Ich probiere, mein Leben ein bisschen zu leben, wie es die Philosophie des Stoizismus predigt. Im Grunde ist das auch eine Religion und Dinge, an die man glaubt. Wenn man nicht unbedingt religiös ist, sind es oft Philosophien, an die man glaubt oder die einen vergleichbaren Stellenwert einnehmen.
Wie bist du darauf gekommen?
Ich habe einen ziemlich philosophisch behafteten Freundeskreis. Wir haben oft Tage und Abende, an denen wir mit einer Flasche Wein über den Sinn des Lebens diskutieren und probieren, die Philosophien einfließen zu lassen. Das tue ich schon aktiv.
Reflexion, Ausgeglichenheit und diese Grundzufriedenheit kommen auch am Album rüber.
Der Stoizismus war auch da für mich sehr prägend – such‘ dein Glück in dir selbst und nicht in irgendwelchen Außenposten. Ich habe mich in der Coronazeit sehr daran gehalten, Kontakte zu reduzieren. Da ist mir aufgefallen, wie viele Leute in meinem Leben sind, mit denen ich mal was mache, aber gar keinen emotionalen Benefit rausziehe. So hart das jetzt klingt. Es war vielleicht auch dieses Loslassen von Menschen und Lebenssituationen. Der Stoizismus predigt ja: sei leidenschaftslos.
Du switcht in deinen Texten teils zwischen der Erzählerrolle und der Beobachterrolle. Hast du das bewusst gemacht?
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich beobachte gerne. Meine größte Inspiration sind Menschen, die ich um mich herum habe. Bei „Löwenzahn“ rappe ich zum Beispiel über eine Trennung, die nicht meine eigene ist. Manchmal stagniert das Künstlerleben ja. Wenn drei, vier Jahre alles cool läuft, gehen dir irgendwann die Themen aus. Ich finde, man kann und muss sich auch ein bisschen an seinem Umfeld bedienen und deshalb kommt die erzählerische Beobachterrolle hin und wieder durch. Gerade das macht ja auch die Kunst aus, finde ich: es so zu erzählen, als wäre es von einem selbst.
Beim Track „Rap ist“ muss man sofort an Max Herre denken. Auch du singst darin „Rap ist Geheimtipp und populärste Musik“. Was ist Rap für dich?
Ich bin ein großer Max-Herre-Fan. Ich finde, er ist einer der wenigen, der wunderschön gealtert ist mit seinem Sound und ein großes Vorbild für mich ist. Ich habe „Rap ist“ so geschrieben, wie der Song ist, weil es die Wahrheit ist. Ich werde oft gefragt, was Rap ist und wie ich mich in der Rapszene fühle, gerade als Frau. Rap ist für mich vielleicht nicht das, was es für andere ist. Es gibt Interpreten, die machen fetteste Kohle und haben mit einem Album ausgesorgt, aber ich bin mit dem „Each One Teach One“-HipHop aufgewachsen. Meine Community war voller Liebe. Das ist für mich HipHop, das Miteinander sein, cool zueinander sein und einander zu unterstützen. Ein authentischer Untergrundbereich. Ich will schon auch ein bisschen in die Popschiene, das hört man auch an meinem Album. Aber die Rap-Message soll trotzdem bleiben. Wir sind alle normale Leute und keine Superstars, selbst wenn mal eine Halle ausverkauft ist.

Wann war klar, dass ihr das Band-Element beim Album in den Vordergrund rückt?
Ich wollte schon lange mit einer Band live spielen. Hauptsächlich ging es darum, dass ich oft gehört habe, dass Rap mit produzierten Beats so Steckdosenmusik ist – ein künstlicher Sound. Ich wollte dann auch mal beweisen, dass das durchaus auch mit Live-Brand auf einem Album umsetzbar ist. Ich kenne das nicht so im Rap, dass man mit Live-Band spielt. Und ich denke, wir haben einen guten Mittelweg gefunden. Wenn man mich rappen hört, hält sich die Band zurück. Wenn ich nichts zum Sagen habe, kann die Band Stoff geben. Der Geist der Studiosessions hat auch ein bisschen mitgewirkt.
War es ein Thema, dass ihr einen Bandnamen bekommt?
Ja, Rudi war zum Beispiel für „Spilif and the other guys“. Ich nehme Yasmo & die Klangkantine als Beispiel. Die Klangkantine spielt auch ohne Yasmo Konzerte. Aber meine Band spielt, wenn ich nicht dabei bin, keine eigenen Shows. Deswegen haben wir es dann bei Spilif belassen. Spilif & Rudi Montaire heißen wir, wenn ich mit ihm als DJ spiele.
„Ich warte nicht mehr so oft darauf, dass mich die Muse küsst, sondern fange einfach an“
Schreibst du deine Texte ausschließlich selbst?
Ja ich finde, das ist das Minimum. Sollte ich jemals einen Ghostwriter brauchen, würde ich das Mikro an den Nagel hängen. Ich würde auch Ghostwriting übernehmen, ich habe schon manchmal über Schlager nachgedacht (lacht). Das wäre wahrscheinlich recht einfach, aber no front. Ich mache daneben auch Schreibworkshops. Meist mit Jugendlichen in Schulen oder Jugendhäusern, aber auch für Erwachsene. Das Programm variiert natürlich dementsprechend je nach Sprachverständnis, Einstellung, Erfahrung und Aufmerksamkeitsspanne. Aber ich mache das sehr gern und finde, dass Rap dafür perfekt ist. Du musst keinen Ton treffen oder singen können. Wenn du das Taktgefühl hast, kannst du schnell was machen. Wie du auf der Gitarre schnell mal „Wonderwall“ spielen kannst.
Du hast mal gesagt, dass du, wenn du singen könntest, wahrscheinlich nicht rappen würdest. Am neuen Album geht es aber schon ein bisschen mehr in die Gesangsrichtung als bei den alten Tracks.
Das hat sich durch die Band melodisch entwickelt und ich habe auch zum Beispiel viel Mac Miller im Entstehungsprozess gehört. Eigentlich bin ich aber froh, dass ich nicht singen kann. Hätte ich singen können, hätten mich die rappenden Jungs im Proberaum damals einfach die Hook singen lassen. Aber weil ich so schrecklich gesungen habe, haben sie mich halt auch rappen lassen.
Kannst du benennen, wie bei dir die Inspiration für Texte kommt?
Liebe, Leidenschaft und der spontane Moment sind wichtig, aber ich denke, du musst es auch mal zum Handwerk machen. Ich will auch schreiben können, wenn ich uninspiriert bin oder nichts passiert. Ich warte nicht mehr so oft darauf, dass mich die Muse küsst, sondern fange einfach an.
Hat es Phasen gegeben, in denen dir das Rappen auf die Nerven gegangen ist?
Ja, während Corona, bevor ich das Album geschrieben habe. Da habe ich mich gefragt, wofür überhaupt. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich es einfach für mich mache – und das ist ein ziemlich guter Grund. Mir würde etwas fehlen und ich glaube das macht mich auch zur Künstlerin. Ich glaube nicht, dass ich es lassen könnte. Es ist fast schon ein Zwang.
Sind weitere Projekte mit der Band geplant?
Ja, es gibt schon Demos. Wir wollen mit einem zweiten Album anschließen. Die Jungs wollen wieder klassischere HipHop-Sound, ich will bisschen weg davon, es noch jazziger halten. Es ist natürlich Zukunftsmusik, aber wir werden sicher eine gute Mischung finden. Mein Ziel ist noch ein bisschen mehr Alleinstellungsmerkmal.
Gibt es einen Traum?
Irgendwann hätte ich gerne ein Konzert in einem Theater oder in einem richtigen Konzerthaus, bestuhlt mit rotem Samtstühlen und mit einem Orchester oder einem Männerchor. Es soll so nah am HipHop sein, dass die Leute es fühlen, aber auch so weit weg davon, dass es denen, die sonst eigentlich keinen Rap hören, auch taugt.
Ähnliche Posts
- Nardwuar gibt selbst ein Interview
Jetzt ist er selbst dran: Nardwuar, der prominente Musikjournalist, steht Pharrell Rede und Antwort. Doch wie…
- Hip Hop Messages: Masta Ace Interview
Der mittlerweile 45-jährige und stets freshe New Yorker Rapper Masta Ace im Video-Interview über sein…
- Spilif hat eine Liebe für HipHop // Video
Die HipHop-Plattform Open Minded aus Salzburg legt ihren Fokus auf das Veranstalten von Jams und…