"The hardest thing to do is something that is close…
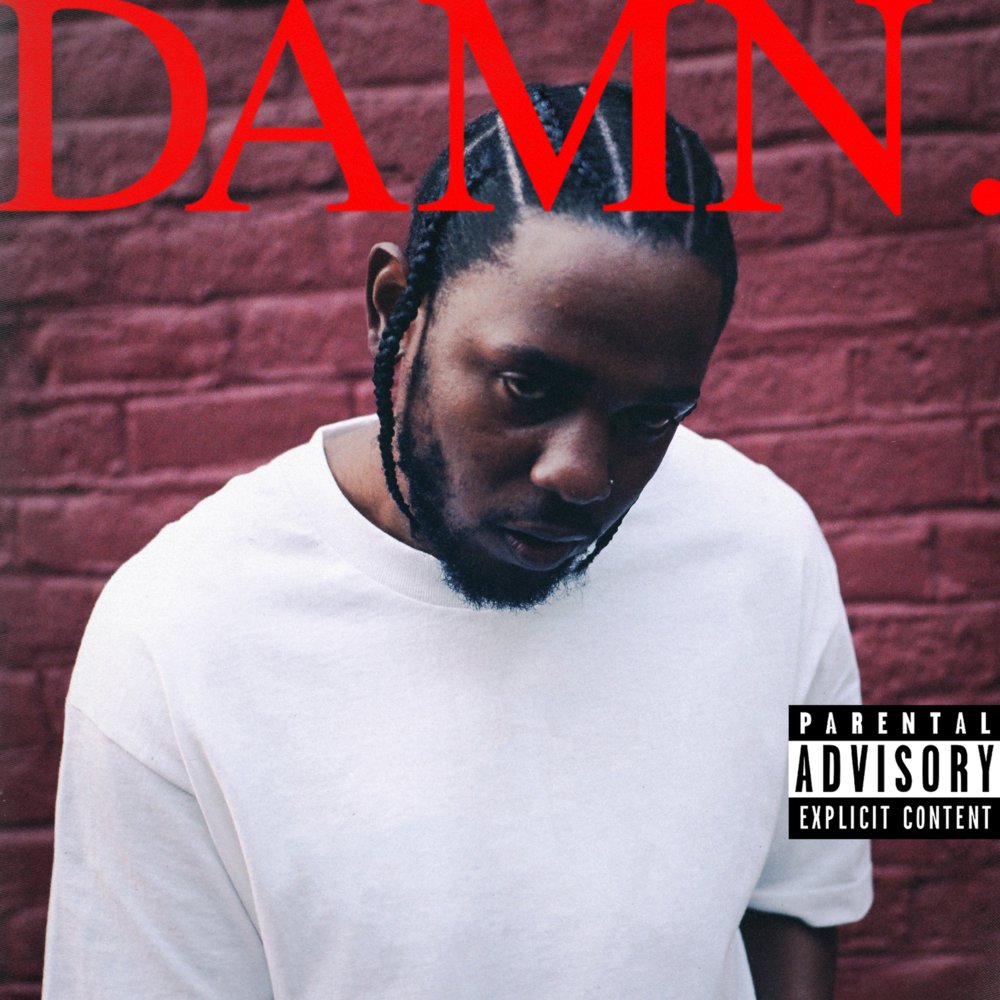
Wie oft Kendrick Lamar in den vergangenen Monaten ein „Damn“ über die Lippen kam, als er die Nachrichten seines Heimatlandes verfolgte? Die genaue Anzahl ist nicht überliefert, aber verbale Eskapaden seines Präsidenten, blutige Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und Antifa in Berkeley, Polizeigewalt gegen Afro-Amerikaner und reißerische Berichte von Fox News sind auf jeden Fall gute Anlässe, um ein seufzendes „Damn“ auszustoßen. Einen ausdrucksstärkeren Albumtitel hätte Kendrick Lamar für sein viertes Album also nicht finden können. „DAMN.“, wie alle Songtitel auf dem Album in Capslock geschrieben, ist vielleicht aber nur Ausdruck der Situation, in der sich Kendrick musikalisch nach dem epochalen „To Pimp a Butterfly“ vorfand. Getreu dem zermürbenden Befund: „Verdammt, wie soll ich das noch steigern?“
Eine Steigerung von „To Pimp a Butterfly“, dessen Leftovers in Form von „Untitled Unmastered“ viele reguläre Alben locker in die Schranken wiesen, ist in der Tat schwer möglich. Weswegen Kendrick Lamar auf „DAMN.“ sich gar nicht an einer Fortsetzung versuchte. Glücklicherweise, mögen viele sagen: War der Vorgänger an Kopflastigkeit kaum zu überbieten, fällt das neue Werke im Vergleich deutlich hörbarer und lockerer aus. Wobei sich diese Lockerheit in erster Linie bei der Soundgestaltung widerspiegelt. „DAMN.“ ist musikalisch schlichtweg simpler gehalten: Kein überbrodelnder Eklektizismus mehr, keine effektreichen, überladenen Beats mit Kamasi-Washington-Saxophon-Outro. Sondern manchmal regelrechte Brachial-Stampfer von Mike Will Made It, die normalerweise Rae Sremmurd gut zu Gesicht stehen. Die erste Single „HUMBLE.“ wirkt somit wie eine Antwort Kendrick Lamars auf „Black Beatles“.
Die beschriebene Lockerheit setzt sich textlich zwar fort, unterliegt aber bestimmten Einschränkungen. Obwohl eine durchgängige Story wie auf „Good Kid, M.A.A.D City“ oder „To Pimp a Butterfly“ fehlt, stechen zwei zentrale Motive auf „DAMN.“ hervor: Einerseits Kendricks mentaler Zustand, der sich trotz (oder wegen?) des ganzen Erfolgs und Ruhms scheinbar am Tiefpunkt befindet. Folgerichtig durchzieht ein Gefühl tiefen Schwermuts das Album; mehr als auf seinen Veröffentlichungen zuvor, in denen depressive Töne zwar ebenfalls vorzufinden waren („u“ auf „To Pimp a Butterfly“ sei hier genannt), aber nie in einer solchen Häufigkeit und Intensität. „Verdammt, geht es mir schlecht“, dürfte oft in Kendrick Lamars Kopf geschwirrt haben, bevor er sich an das Werk machte. Ein Ergebnis davon das hervorragende, bluesige „FEEL.“ mit der grundlegenden wie verzweifelt wirkenden Feststellung: „Ain’t nobody prayin’ for me“.
Die zugleich zum zweiten zentralen Motiv auf „DAMN.“ führt: Religion. Religiöse Referenzen finden sich bereits in der Tracklist vor, die mit den Titeln „LUST.“ und „PRIDE.“ auf zwei der sieben Todsünden anspielt. In den Lyrics nimmt das Motiv eine noch gewichtigere Rolle ein – und zwar von Beginn an: Die Metapher im gesprochenen Intro „BLOOD.“, das von einer blinden Frau handelt, die den Hilfe bietenden Kendrick Lamar erschießt, ist dem 5. Buch Mose (beziehungsweise Deuteronomium) entnommen und weist auf eine zentrale religiöse Dichotomie des menschlichen Umganges mit Gott hin, die Lamar scheinbar tief beeindruckt hat. Die Entscheidung gestaltet sich dabei entweder in einer Bewusstwerdung der eigenen, menschlichen Schwäche und einer Unterordnung gegenüber Gott – oder einem Negieren dessen, mit der Versündigung und dem Weg in die Verdammnis als Konsequenz. Auf diese Dichotomie greift Kendrick Lamar in vielen Tracks zurück, was Spekulationen darüber, ob es sich bei „DAMN.“ eigentlich um zwei Alben handle, nährte.
Doch Kendrick beschränkt sich nicht nur auf diesen impliziten Zugang, sondern spricht Religion in Tracks wie „YAH.“, „FEEL.“, „XXX.“, „FEAR.“ oder „GOD.“ explizit an. Besonders interessant dabei seine Hinwendung zu den „Black Hebrews“, die in einer Line auf „YAH.“ („I’m a Israelite, don’t call me Black no mo’“) sowie als Voicemail seines Cousins Carl Duckworth auf „DAMN.“ stattfindet. Diese Voicemail ist vor allem aufschlussreich, um Einsicht in Kendrick Lamars Gedankenwelt auf „DAMN.“ zu erhalten: Carl Duckworth zitiert darin das dritte Kapitel aus dem Buche Amon und erklärt die Ungerechtigkeiten, denen Native Americans, Afro-Amerikaner und Latinos in den USA ausgesetzt sind, als Folge eines Fluches, der auf ihnen als die wahren Kinder Israels laste.
Ungerechtigkeiten, die Kendrick Lamar auf „DAMN.“ jedoch nicht in beißender politischer Kritik oder verbalen Schüssen gegen Donald Trump kanalisiert, was von vielen, nicht zuletzt bedingt durch „The Heart Part IV“, erwartet wurde. „DAMN.“ verzichtet sogar auf ein typisches Protestlied der Marke „Alright“. An großen Titeln mangelt es dem Album trotzdem nicht. Wofür die beiden prominentesten Features, die beim Bekanntwerden zunächst einige Befürchtungen weckten, keine unscheinbare Rolle spielen.
Erweisen sich sowohl die radiofreundliche Sing-Sang-Nummer „LOYALTY.“ mit acht Zeilen Rihanna-Rap als auch die U2-Kollabo „XXX.“ als Manifeste großer Musikkunst, jeweils auf ihre eigene Art: So besticht „LOYALTY.“ durch erfrischend unaufdringlichen Pop-Appeal, „XXX“ hingegen durch beeindruckende inhaltliche Tiefe und einer Hook von Bono Vox, die zwar an ein Sample erinnert, aber dem Song einen besonderen Touch verleiht. Denn wer hätte besser auf einem durchgängig politischen, zugleich so analytisch präsentierten Track gepasst als eine der größten Rock-Bands der Geschichte, die zwar seit 2000 kein anständiges Album mehr veröffentlicht hat, aber mit überlebensgroßen, hochpolitischen Nummern wie „Sunday Bloody Sunday“ sich schon in den 80er-Jahren ein gewichtiges Stück vom Kuchen der Popmusik-Historie sicherte? Eben. In dieser Hinsicht eine absolut treffende Featurewahl.
Ebenso außergewöhnlich, aber nicht minder funktionierend erwies sich die Entscheidung einer Beteiligung des legendären New Yorker DJ Kid Capri, der dem Album dank seiner Ansagen („What happens on Earth stays on Earth“) einen überraschenden Mixtape-Anstrich verleiht. Dafür sorgt jedoch nicht nur Capri, sondern Kendrick Lamar selbst, der sich auf „DAMN.“ stellenweise die Freiheit für manch ungezwungenes Songmaterial („DNA.“) nimmt. Nur ein Indikator für den Facettenreichtum des Album, das neben Sing-Sang-Tracks in Drake-Manier und kompromisslosen Representern auch beeindruckende Storytelling-Tracks beinhaltet. Mit einem Beweis seiner Qualitäten in letztgenannter Kategorie beendet Kendrick Lamar das Album. Auf einem souligen, 9th-Wonder-Trademark-Sound-Beat wird in „DUCKWORTH.“ die Geschichte des Zusammentreffens von Kendrick Vaters Ducky und TDE-Labelgründer Anthony „Top Dawg“ Tiffith erzählt, lange bevor Kendrick als Rapper durchstartete. Ein imposantes Stück Rapmusik, wie so viele Nummern auf „DAMN.“.
Fazit: Mit „DAMN.“ liefert Kendrick Lamar kein zweites „To Pimp a Butterfly“. „DAMN.“ enthält einen ganz anderen Sound, der einen Spagat zwischen Trap-Anleihen und 70er-Jahre-Soul aufbietet. Auch die Komplexität von „To Pimp a Butterfly“ erreicht „DAMN.“ nicht, was jedoch die Hörbarkeit deutlich steigert. Für „Easy Listening“ sind seine Inhalte immer noch nicht geeignet, Kendrick Lamar bietet wieder eine große Menge an intellektuellem Material auf, sei es bei der Beschreibung seines mentalen Zustands oder bei seiner Auseinandersetzung mit religiösen Fragen. Vor allem liefert Kendrick Lamar aber absolute Bestleistungen in allen Rapperdisziplinen, egal ob Representer, Lovesong oder Storytelling-Track. Wie Kendrick über die Beats flowt, ist schlichtweg atemberaubend. Ein Frage wird er sich trotzdem wieder stellen müssen. Nämlich: „Verdammt, wie soll ich das noch steigern?“.

Ähnliche Posts
- KENDRICK LAMAR - TO PIMP A BUTTERFLY
Kendrick Lamars neues Album „To Pimp A Butterfly“ stürmt direkt die Charts und löste…
- Kendrick Lamar mit Kurzfilm
Zum Jahresende noch ein audiovisuelles Statement vom Bestenlisten-König Kendrick Lamar. Für den fulminanten Kurzfilm "God…
- Kendrick Lamar mit Kurzfilm
Zum Jahresende noch ein audiovisuelles Statement vom Bestenlisten-König Kendrick Lamar. Für den fulminanten Kurzfilm "God…








